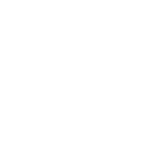United we talk
Laura Späth:
Bitte nicht zurück
Laura Späth: Bitte nicht zurück
Physical distancing ist nötig
Social distancing ist tödlich
Und eine andere Welt ist möglich
Zeigt Corona.
Die Krise erleben alle Menschen unterschiedlich. Was nicht heißt, dass es keine gemeinsamen Forderungen geben kann. Denn die wird es brauchen, die braucht es schon jetzt. Der Virus zeigt, dass unterschiedliche Situationen unterschiedliche Bedürfnisse hervorbringen und dass unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedliche Lösungsansätze erfordern.
Die größte Lüge im Angesicht von Corona: Vor dem Virus sind endlich alle gleich. Die Wahrheit, die die Lüge auch transportiert: Schon davor waren nicht alle gleich.
Pandemie-Lernprozess Part 1: Care-Arbeit ist unverzichtbar.
Letztendlich wird die Pandemie an den Stellen einer Gesellschaft problematisch, auf die davor nicht richtig aufgepasst wurde und die davor schon von Krisen durchzogen waren.
Corona hat sich auf die Carearbeit gestürzt. Auf jede einzelne mögliche Sphäre der Carearbeit.
Wenn ich Carearbeit sage, meine ich Carearbeit in all ihren Facetten: physisch, psychisch, bezahlt, unbezahlt und unterbezahlt: Ich meine die Pflegekräfte in Krankenhäusern und die alleinerziehenden Eltern in prekären Jobs. Ich meine die
Erzieher_innen und Altenpfleger_innen, ich meine all die Tätigkeiten, die zum Teil noch nicht einmal als Arbeit anerkannt sind und unbezahlt bleiben, wie innerfamiliär organisierte Haus-, Beziehungs- und Erziehungsarbeit. Ich meine diese Tätigkeiten – sie sind weiblich konnotiert – die faktisch dafür sorgen, dass unser Alltag funktioniert, die so elementar für Gesellschaft sind, dass wir sie nicht einmal mehr bemerken. Erst dann, wenn wir uns nicht mehr auf sie verlassen können.
Die Pandemie stellt die Basis infrage. Sie zeigt die Grenzen des menschlich Möglichen, aber vielleicht auch, dass gesellschaftlich mehr möglich ist als man denkt. Nur zusammen.
Wenn wir aus Corona lernen wollen, müssen wir fragen, warum wir Care-Arbeit vor der Krise so selbstverständlich hingenommen haben. Warum sie so schlecht bezahlt wurde. Warum sie kaum anerkannt war.
Die Sache wird nicht besser, wenn man nur die Forderung nach mehr Wertschätzung und besserer Bezahlung stellt. Das Problem liegt in einem Kapitalismus, der noch dazu auf patriarchalen Strukturen aufbaut.
Das Gesundheitssystem ist profitorientiert organisiert. Kein Platz für Menschen, kein Geld für Pflege, Kapitalismus setzt Grenzen. Die Grenzen, an die Corona uns bringt.
Das Gesundheitssystem hat lange funktioniert, wie es nie mehr funktionieren darf. Deshalb darf »nach Corona« nicht heißen »Zurück dahin, wie es war.«
Historisch gesehen gehen Gesellschaften aus Pandemien autoritärer hervor. Staatliche Befugnisse werden selten freiwillig zurückgezogen und niemand wird Geld für Carearbeit verschenken.
Deshalb wird man sich gesellschaftliche Veränderung erkämpfen – müssen. Mit einer Solidarität, die anders aussieht als die, die jetzt beschworen wird. Eine Solidarität, die verbindet, statt begrenzt. Eine Solidarität, die mit physical distancing umgehen kann, aber dem social distancing eine Absage erteilt.
Pandemie-Lernprozess Part 2: Das soziale Leben ist unverzichtbar, genau wie Carearbeit.
Die Lösung für das Problem wird nicht die bessere Bezahlung von allen Arbeiten sein, die sich jetzt als systemrelevant erweisen.
Die Lösung wird nicht darin bestehen, in sozialer Distanziertheit zu verweilen und isoliert und vereinzelt zu bleiben.
Die Lösung steckt in unseren Beziehungsweisen. Und die müssen neu gedacht werden.
Beziehungen untereinander, Beziehung zur Gesellschaft. Sodass niemand zurück- und allein gelassen bleibt. Sodass niemand verloren geht in gesellschaftlicher Unsichtbarkeit.
Nicht die Leute, die von häuslicher Gewalt bedroht sind. Nicht die Menschen an den EU-Außengrenzen. Nicht die alleinerziehenden Mütter. Nicht die Menschen, die mit mentaler und körperlicher Gesundheit strugglen. Nicht die, die viel zu lange schweigen mussten.
Feministische Solidarität wird heißen: Niemand bleibt allein. Weil Vereinzelung tötet. Weil Einsamkeit tötet. Weil Leute da leiden und sterben, wo niemand mehr hinsieht, wo Situationen sich den Blicken entziehen.
Man wird feministische Solidarität brauchen. Eine, die die alltäglichen Beziehungen in den Blick nimmt. Eine, die das neu denkt, auf dem wir das alltägliche Leben aufbauen.
Eine, die über Grenzen des Möglichen hinausdenkt, denn Corona hat die Rahmung bereits gesprengt. Corona begrenzt und erweitert Handlungsspielräume.
Wieso ein kapitalistisches Gesundheitssystem, wenn der Virus gezeigt hat, dass es ihm nicht gewachsen ist? Ein anderes ist möglich.
Wieso Carearbeit weiterhin als bedingungslos ansehen und zu bedingungslos leisten, wenn alle wissen, wie wenig bedingungslos sie eigentlich ist? Ein anderes ist möglich.
Wieso social distancing, wenn es social converging gibt? Ein anderes ist möglich.
Alle sprechen über »zurück« – Zurück zum Alltag, zurück zu »wie es vor Corona war«, zurück zum Alten.
Wieso nicht vorwärts? Wieso nicht von Corona aus neu denken, um aus der Krise zu lernen?
Corona spitzt zu, auf was feministische Bewegungen seit Jahren aufmerksam machen:
Nur weil Tätigkeiten konsequent unsichtbar gemacht werden, sind sie nicht weniger relevant.
Nur weil wir uns auf bestimmte gesellschaftliche Angebote ganz alltäglich berufen und verlassen, sind sie nicht selbstverständlich.
Nur weil patriarchale Strukturen seit Langem bestehen, sind sie nicht unangreifbar.
Und nur weil Menschen in der Vergangenheit unsichtbar und leise waren, heißt das nicht, dass es so bleibt.
Zeit, die Forderungen dieser Bewegungen wahr- und anzunehmen. Zeit, Neue zu stellen.
Zeit, für Neues zu kämpfen. Zeit für Solidarität, die Verbindungslinien schafft, anstatt neuer Grenzen.
Auch wenn viel Erde inzwischen verbrannt ist, die Forderung ist, war und bleibt nicht weniger als: Für ein ganz anderes Ganzes.